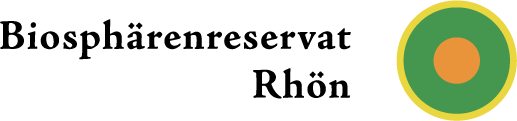„Warum gibt es jeden Tag Millionen an Geld für den Krieg und keinen Cent für die Heilkunde, für die Künstler, für die armen Menschen? Warum müssen die Menschen Hunger leiden, wenn in anderen Teilen der Welt die überflüssige Nahrung wegfault? Oh, warum sind die Menschen so verrückt?“
Anne Frank, Tagebucheintrag vom 03. Mai 1944
Als Anne Frank im Alter von dreizehn Jahren ihr Tagebuch geschenkt bekam, ahnte niemand, welche historische Bedeutung diese persönlichen Aufzeichnungen einmal haben würden. Nachdem ihre Familie vor den Nationalsozialisten nach Holland geflohen war, musste sie sich dort ebenfalls verstecken, als die Verfolgung auch die Niederlande erreichte: Schließlich wurde sie am 03. September mit einem der letzten Transporte ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, wo ihr junges Leben einen grausamen Verlauf fand. Etwa ein halbes Jahr später fand sie im KZ Bergen-Belsen im Alter von nur fünfzehn Jahren den Tod. Doch ihre Worte überlebten: Nach Kriegsende erhielt ihr Vater Otto Frank die Aufzeichnungen seiner Tochter und entschied sich nach langem inneren Ringen für deren Veröffentlichung.
Diese Gedanken, die Anne Frank uns in ihrem Tagebuch hinterließ, zeichnen sich besonders dadurch aus, wie sie trotz der erschütternden Umstände ihren Humor und ihre Zuversicht bewahrte. Dabei nahm Anne jedoch die Schrecken ihrer Zeit mit bemerkenswerter Klarheit wahr. Ihre in jungen Jahren geschriebenen Aufzeichnungen entwickelten sich zu einem der wichtigsten und intimsten Zeugnisse der NS-Diktatur. Der weltweite Einfluss ihres Werks spiegelt sich in beeindruckenden Zahlen wider: Mit 30 Millionen verkauften Exemplaren in über 70 Sprachen gehört es heute zur Weltliteratur. Die Aufnahme in das UNESCO-Weltdokumentenerbe im Jahr 2009 zeigt zusätzlich die Bedeutung ihrer Aufzeichnungen für die aktuelle Zeit, die auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt berühren und zum Nachdenken anregen.
Im Staatstheater Meiningen wurde das Tagebuch als Monolog auf der Theaterbühne eindrucksvoll umgesetzt, der sich vollständig auf die Originalaufzeichnungen stützt. Die Inszenierung ermöglicht durch ihre intime Form einen direkten Zugang zu Annes Gedankenwelt. In einem bewusst minimalistisch gehaltenen Bühnenbild, das die bedrückende Enge des Verstecks atmosphärisch einfängt, steht die Schauspielerin Alina Gitt im Mittelpunkt. Sie trägt die gesamte emotionale Last des Stücks zwischen jugendlicher Lebensfreude und der erdrückenden Realität von Annes Situation.
Theater ist auf der menschlichen Ebene wirksam
Mit der Stückauswahl besetzt das Theater ein Thema, das einen Beitrag zur politischen Bildung leisten kann: In einer Zeit, in der Deutschland vor einer richtungsweisenden Bundestagswahl steht und rechtspopulistische Kräfte in den Umfragen bei über zwanzig Prozent liegen, gewinnt der Theaterbesuch zu Anne Franks Geschichte besondere Bedeutung. Gerade in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Anne Franks Geschichte können Jugendliche die Bedeutung von Toleranz, Menschlichkeit und demokratischen Grundwerten erfahren und verstehen, warum es auch heute wichtig ist, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung einzustehen. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es auch von Bedeutung, dass Anne Frank in etwa dem gleichen Alter war wie sie, als sie ihre Gedanken zu Papier brachte – eine Situation, die ihr Schicksal besonders greifbar macht. Das Theaterstück ermöglicht Schülerinnen und Schülern nicht nur einen emotionalen Zugang zur Geschichte des Holocaust, sondern schafft auch wichtige Bezüge zur Gegenwart.
Schülerinnen und Schüler als Teil einer Radiosendung
Das Gemurmel der Schülerinnen und Schüler verstummt schlagartig, als Merle, die Radiomoderatorin mit dem Lächeln einer halbherzigen Entschuldigung, auf die Bühne tritt: „Oh hi, schön, dass ihr auch da seid”. Ihre Stimme klingt warm und ein bisschen zu lau, als wüsste sie, dass gleich etwas Wichtiges passiert. Die Bühne gehört jetzt ihr: „Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Oranje FM”, fährt sie fort, während sie ihr Mikrofon justiert. „Heute widmen wir uns einer jungen Frau, deren Worte die Welt verändert haben. Es ist eine Hommage an Anne Frank und ihr Tagebuch, fünfundsiebzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung.”
Mit gespannter Aufmerksamkeit verwandeln sich die Schülerinnen und Schüler nun in das Publikum der Radiosendung „Oranje FM”. Merle und ihre Technikerin Nadja haben eine besondere Sendung vorbereitet, bei der eine transparente Radiobox als einziges Bühnenelement dient. Sie symbolisiert die beengende Atmosphäre des Verstecks und verdeutlicht gleichzeitig die wichtige Rolle des Radios als Verbindung zur Außenwelt. Mit ihren einleitenden Worten nimmt Merle die Zuhörer mit auf eine bewegende Zeitreise, die die Geschichte weit über die persönlichen Aufzeichnungen eines Tagebuchs hinaus lebendig werden lässt.
Ganz allein auf der Welt
„Es beginnt an einem Geburtstag“, sagt Merle, und ihre Stimme hat ab jetzt einen Ton, der zwischen Erzählung und Erinnerung von Anne schwebt. „Ich habe keine Freundin. Niemand kann verstehen, dass ein Mädchen von 13 ganz allein auf der Welt steht.“ Früh stellt sich deswegen die besondere Beziehung zwischen Anne und ihrem Tagebuch heraus, das sie spielerisch und liebevoll „Kitty“ nennt und das zu ihrer engsten Vertrauten wird. Und inzwischen weiß der Zuschauer oder die Zuschauerin in der komplexen Situation im Theater nicht mehr, wer überhaupt spricht: Ist es die Radiomoderatorin Merle oder Anne?
Bedrohung der jüdischen Bevölkerung
Die zunehmende Bedrohung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten wird im weiteren Verlauf durch Annes Aufzählung der anti-jüdischen Gesetze verdeutlicht. In einem Monolog listet sie die schrittweise Ausgrenzung und systematische Entrechtung der jüdischen Bevölkerung auf und zeigt dabei, wie zynisch und kompromisslos die bürokratische Sprache des NS-Regimes das alltägliche Leben durchdrang:
„Juden müssen einen Judenstern tragen.
Juden müssen ihre Fahrräder abgeben.
Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren.
Juden dürfen nur zwischen drei und fünf Uhr einkaufen.
Juden dürfen nur zu einem jüdischen Friseur.
Juden dürfen nach acht Uhr abends nicht auf die Straße.“
„Ich mache mir eben mehr aus Erinnerungen als aus Kleidern“
Fotos: Theater Meiningen, Christina Iberl
Diese bedrohliche Situation spitzt sich zu, als Annes Schwester Margot einen Aufruf der SS erhält. Daraufhin muss die Familie überstürzt untertauchen: „Wir zogen uns alle vier so dick an, als müssten wir in einem Eisschrank übernachten. Und das nur, um noch ein paar Kleidungsstücke mehr mitzunehmen“, schreibt Anne. In dieser verzweifelten Lage wird das Hinterhaus in der Prinsengracht 263, versteckt hinter Otto Franks Firma “Opekta”, zum rettenden Zufluchtsort für insgesamt acht Menschen. Das Leben an diesem geheimen Ort ist jedoch alles andere als einfach, denn der Alltag im Versteck wird durch strenge Regeln bestimmt: „Absolute Stille während der Bürozeiten, verdunkelte Fenster, leises Gehen und Sprechen, keine Toilettenspülung nach Büroschluss, streng rationierter Wasserverbrauch“, führt Anne im Tagebuch aus.
Nächtliche Bombardierungen
Die Luftangriffe der Alliierten bedeuten zusätzlichen Stress für die Versteckten. Anders als die übrige Bevölkerung konnten sie bei Fliegeralarm nicht in Luftschutzbunker flüchten. Deswegen gehören zu Annes Alltag auch sich nächtlich wiederholende Bombardierungen. Anne beschreibt in ihrem Tagebuch das dumpfe, dröhnende Donnern in der Ferne:
„8 Uhr: Die Sirenen haben mich geweckt
9 Uhr: Habe mich unter dem Kopfkissen verkrochen
13 Uhr: Habe meine Fluchttasche gepackt
15 Uhr: Wieder Sirenen gehört.“
Liebe als poetische Kraft
Diese belastende Situation verschärfen auch die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Versteckten. Annes komplizierte Beziehung zur Mutter wird zum Beispiel in mehreren Szenen thematisiert: „Ich kann Mutter einfach nicht ausstehen. Ich muss mich jeden Tag mit Gewalt zwingen, sie nicht anzuschnauzen oder anzuschreien. […] Ich könnte ihr auch einfach glatt ins Gesicht schlagen“. Während Anne mit diesen heftigen negativen Gefühlen gegenüber ihrer Mutter ringt, findet sie in der sich entwickelnden zarten ersten Liebe zu Peter van Daan einen emotionalen Ausgleich.
Diese emotionale Ambivalenz spiegelt sich auch in einem besonders intimen Aspekt des Stücks wider: Der Darstellung von Annes körperlicher und seelischer Entwicklung während der Versteckzeit. Mit Offenheit thematisiert es ihre ersten Erfahrungen mit der Pubertät. Annes Nachdenken über ihre erste Menstruation ist dabei von besonderer Bedeutung: „Immer wenn ich meine Periode bekomme, habe ich das Gefühl, dass ich trotz der Schmerzen, des Unangenehmen und Ekligen, ein süßes Geheimnis in mir trage.“
Etwas Bedeutendes schaffen
Diese persönliche Reifung wird noch verstärkt durch einen bedeutsamen historischen Wendepunkt: Die Nachricht von der Invasion der Alliierten in der Normandie, dem D-Day. Im Stück wird dies durch authentische Radiomeldungen verdeutlicht. Annes Reaktion darauf ist voller Hoffnung. Sie träumt bereits von einem Leben nach dem Krieg und fragt sich: „Vielleicht kann ich im September oder Oktober wieder zur Schule gehen?”. Trotz der schrecklichen Umstände wird Anne durch Hoffnung getragen, die im Stück symbolisch als Tattoo in ihrer Haut eingeschrieben ist. Sie glaubt an die Güte der Menschen und an eine bessere Zukunft nach dem Krieg, in der sie Schriftstellerin werden will, um etwas Bedeutendes zu schaffen.
Diese optimistische Grundhaltung steht im Kontrast zu Merles nachdenklicher Reflexion im Radiostudio. Als ein Anrufer die Frage aufwirft, ob solche Ereignisse heute wieder möglich wären, antwortet sie mit Bedacht: „Ich glaube nicht, dass wir heutzutage schlauer sind als vor 80 Jahren. Das hat ja auch gar nichts mit Intelligenz zu tun.”
Ein weiterer Anrufer aus Weimar erkundigt sich nach dem Leben der nicht-jüdischen Niederländer während der Besatzung. Dabei wird erwähnt, dass über 80 Prozent der Studenten sich weigerten zu kooperieren und dafür in Arbeitslager deportiert wurden.
Everything I wanted
Diese Konfrontation mit der historischen Realität spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie das Theaterstück mit Anne Franks Tod umgeht: Ein besonders emotionaler Höhepunkt wurde durch den Livegesang von Billie Eilishs „Everything I wanted“ geschaffen. Anstatt ihren Tod direkt darzustellen, wird er durch die Figur der Radiomoderatorin Merle thematisiert, die zunächst versucht, eine alternative Realität zu erschaffen. In dieser erfundenen Version überlebt Anne den Krieg, geht wieder zur Schule, zieht nach New York und macht dort Karriere als Chefredakteurin der New York Times. Diese bewusste Verweigerung, die historische Realität anzuerkennen, führt schließlich zu einem emotionalen Zusammenbruch der Moderatorin. Sie wird damit konfrontiert, dass sie sich diese alternative Geschichte nur ausdenkt, weil die Wahrheit zu schmerzhaft ist. In diesem Moment bricht ihre konstruierte Erzählung zusammen, und sie muss sich der brutalen Realität stellen: Anne wurde von der SS entdeckt, verhaftet, deportiert und in ein Konzentrationslager gebracht.
Mitverantwortung durch aktives Handeln oder schweigendes Zuhören
„Es sind nicht nur die Mächtigen, die Kriege führen“, stellt Anne am Ende des Theaterstücks fest. Dies schreibt und spricht sie mit einer Weisheit, die weit über ihr junges Alter hinausgeht. „Nein, auch der einfache Bürger trägt dazu bei. Denn wären Kriege unmöglich gewesen, hätte sich das Volk wirklich dagegen gewehrt. Im Menschen selbst liegt der Drang zur Zerstörung, zum Töten und Morden.“ Diese Erkenntnis verdeutlicht: Die Verantwortung für Krieg und Gewalt liegt nicht allein bei den Herrschenden. Jeder Einzelne und jede Einzelne trägt durch sein oder ihr aktives Handeln oder schweigendes Zusehen eine Mitschuld am Verlauf der Geschichte.
Text: Marcel Proksch
Fotos: Theater Meiningen, Christina Iberl