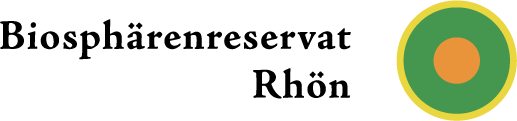Tod und Teufel
Besuch der Ausstellung im Georg-Schäfer-Museum in Schweinfurt
„Vielleicht stimmt es, dass wir nicht wirklich existieren, bis jemand da ist, der uns existieren sieht, und dass wir nicht eigentlich sprechen können, bis jemand da ist, der versteht, was wir sagen: kurz, wir sind nicht ganz lebendig, solange wir nicht geliebt werden“ (Alain de Botton)
Schmerz und Liebe sind zwei Seiten einer Medaille: Statistisch gesehen denken wir täglich über die Liebe nach – so sehr, dass manch einer mehr oder weniger intensiv sein oder ihr Leben danach ausrichtet. Und genauso setzen wir uns auch – ganz unromantisch – mit ihrem Fehlen auseinander. So auch an jenem nebelverhangenen Herbstmorgen Anfang Oktober, an dem sich die Klasse 10 a auf dem Weg zur Ausstellung „Tod und Teufel“ des Georg Schäfer Museums in Schweinfurt machte. Die Luft war kühl und regnerisch-feucht, als die Schülerinnen und Schüler die Erfurter Bahn verließen, ihre Jacken enger zogen und nach einem kurzen Gehweg das Gebäude des Museums erblickten.
Eine Schau, die die Anziehungskraft des Horrors beleuchtet
Diese Ausstellung, eine Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf, versprach eine Erkundung der Faszination des Horrors in der Kunstgeschichte: Mit über 120 Exponaten aus Malerei, Skulptur, Mode, Design, Musik und Film bietet sie einen epochen- und spartenübergreifenden Blick auf die Darstellung von Tod und Teufel. Diese Figuren sind nicht nur Symbole des Schreckens, sondern gleichzeitig auch Projektionsflächen für unsere innersten Ängste und Sehnsüchte.
Beim Betreten der Ausstellung wurden die Schülerinnen und Schüler sofort von Dmitry Smirnovs Fotografie „Zombie Boy“ in den Bann gezogen. Das großformatige Bild zeigte Rick Genest, dessen Körper vollständig mit Skelett-Tattoos bedeckt war. Die Museumsführerin erzählte seine Geschichte: Mit 15 Jahren erkrankte er an einem Gehirntumor. Nach seiner Heilung ließ er sich einen verwesenden Leichnam auf den Körper tätowieren und arbeitete als Model, unter anderem für Lady Gaga. Tragischerweise verstarb er mit 33 Jahren durch einen Unfall. Für die bürgerlich erzogenen Schülerinnen und Schüler warf dies bereits Fragen über die Grenzen von Normalität und Andersartigkeit auf – ein Thema, das sich durch die gesamte Ausstellung ziehen sollte.
Historische Perspektiven auf Tod und Teufel
Die Schülerinnen und Schüler betraten anschließend die düstere Atmosphäre der Museumsräume: Die gedämpfte Beleuchtung und die sorgfältig arrangierten Exponate schufen eine Stimmung, die gleichzeitig beunruhigend und faszinierend war.
Im ersten Ausstellungsraum begegneten sie historischen Werken, die die Verwurzelung von Tod und Schrecken in der europäischen Kunstgeschichte veranschaulichten: Sie standen vor Albrecht Dürers Kupferstich „Der Reiter“, der einen Ritter zeigt, der von Tod und Teufel begleitet wird. Die Museumsführerin erklärte die Kupferstich-Technik und wies auf Details wie die Würmer am Hals des Todes und die Sanduhr in seiner Hand hin. Besonders gebannt standen die Schülerinnen und Schüler vor Friedrich Wilhelm von Schadows Gemälde „Hölle“, das Teil eines Triptychons ist und von Dantes „Göttlicher Komödie“ inspiriert wurde. Die Museumsführerin schuf einen für die Schülerinnen und Schüler bekannten Bezug, indem sie erklärte, dass Schadow der Sohn des Künstlers war, der die berühmte Quadriga auf dem Brandenburger Tor geschaffen hatte.
Die Klasse wurde auch mit dem „Totentanz“ konfrontiert, einer mittelalterlichen Darstellungsform, bei der der Tod mit Menschen verschiedener Stände tanzt. Die Museumsführerin erklärte den historischen Kontext dieser Darstellungen, wie die niedrige Lebenserwartung und hohe Kindersterblichkeit im Mittelalter: Männer wurden durchschnittlich keine 40 Jahre alt, Frauen nur etwa 29 Jahre. Die Jugendlichen erkannten, wie zu dieser Zeit der Tod als Teil des Lebens verstanden und das Böse als allgegenwärtige Bedrohung empfunden wurde.
Ein besonders eindrucksvolles Exponat war der Sarg von Ernestine Friederike von Stockhausen aus dem Jahr 1766. Die Museumsführerin erklärte, dass die adlige Frau mit nur 28 Jahren im Kindbett gestorben war, was damals aufgrund mangelnder Hygiene und fehlender Antibiotika häufig vorkam. Ein weiteres begutachtetes Werk war Johann Heinrich Füsslis Gemälde „Wolfram beobachtet seine Gemahlin in der Kerkerzelle“, das die Schülerinnen und Schüler mit seiner schaurig-romantischen Darstellung zum Nachdenken brachte. Wer wollte, konnte dort auch die Verbindung zwischen klassischer Kunst und moderner Popkultur sehen – denn Künstler wie Füssli legten den Grundstein für viele visuelle Elemente, die heute in Horrorfilmen und -büchern zu finden sind.
Expressionistische Bildsprache in Nosferatu
Dies war auch anhand von Ausschnitten aus Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm „Nosferatu“ zu sehen: Die Jugendlichen nahmen anhand eines Filmausschnitts wahr, wie dieser Film das Bild des Vampirs und des Horrorgenres insgesamt prägte. Die expressionistische Bildsprache und die unheimliche Atmosphäre des Films faszinierten die Schülerinnen und Schüler. „Seht ihr, wie der Regisseur Licht und Schatten einsetzt, um Spannung zu erzeugen?“, fragte die Museumsführerin und der Generation Z kam dies nicht unbekannt vor.
Identität und Widerstand: Verbreitung in Mode und Popkultur
Im nächsten Teil der Ausstellung entdeckten die Schülerinnen und Schüler, wie die Goth-Szene und die Metal-Musik Elemente des Horrors als Ausdruck von Identität und Widerstand nutzten. Dies zeigten zum Beispiel Erasmus Schröters Fotografien des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig, die die extravagante Kleidung und Selbstinszenierung der Teilnehmer zeigten. Die Museumsführerin erklärte dazu, wie Subkulturen oft visuelle Elemente nutzen, um ihre Identität auszudrücken und sich von der Mainstream-Gesellschaft abzugrenzen. Die Schülerinnen und Schüler begutachteten die Frühlingskollektion von Rei Kawakubo für Comme des Garçons, die mit asymmetrischen Schnitten und dunklen Farben spielte. „Würdet ihr so etwas tragen?“, fragte die Museumsführerin und sah in unentschlossene Gesichter.
Auch die Ausstellung von Albumcovern bekannter Metal- und Gothic-Bands interessierte einige Schülerinnen und Schüler. Seit Ende der 1970er Jahre ist die Szene aus der Punk-Bewegung entstanden und hat mit dem WGT in Leipzig ein jährliches Zentrum. Sie erkannten, wie Künstler wie Don Brautigam von Metallica und Derek Riggs von Iron Maiden zu einem Bildkanon beitrugen, der mysteriöse Landschaften, Fabelwesen und esoterische Symbolik umfasst.
Die Schülerinnen und Schüler waren außerdem beeindruckt von der Vielfalt der Musikvideos, die in der Ausstellung gezeigt wurden. „Seht ihr, wie diese Künstler traditionelle Horrorsymbole umdeuten?“, fragte die Museumsführerin nach einer ausführlichen Erläuterung dieser popkulturellen Elemente. Von Lady Gagas „Born This Way“ bis zu Lil Nas X’s „Montero“ wurde gezeigt, wie Horrorelemente genutzt werden, um Themen wie Identität und Widerstand auszudrücken.
Lustig oder geschmacklos? Kunst an den Grenzen
Spannend waren die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf Via Lewandowskys „Selbsttötungsmaschine“ und Kris Martins „Jemand“. „Was empfindet ihr, wenn ihr diese Werke betrachtet?“, fragte die Museumsführerin. Die Meinungen der Schülerinnen und Schüler gingen auseinander, aber alle waren sich einig, dass die Werke zum Nachdenken anregten. Die Schülerinnen und Schüler schauten auf Andres Serranos Fotografie aus der Serie „Das Leichenschauhaus“ und Berlinde de Bruyckeres Skulptur „Im Zweifel II“. Diese Werke forderten sie heraus, über die Grenzen zwischen Schönheit und Abscheu nachzudenken.
Horror und soziale Ungerechtigkeit
Zum Abschluss der Ausstellung setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit Werken auseinander, die Horrorbilder nutzen, um auf soziale und ökologische Missstände aufmerksam zu machen. King Cobras „Rotes Gestell der Geschändeten und Unwilligen“ und Thu Van Trans „Von Grün zu Orange“ regten Diskussionen über historische und aktuelle Ungerechtigkeiten an. Die Museumsführerin ermutigte die Schülerinnen und Schüler, darüber nachzudenken, wie Kunst als Mittel des sozialen und politischen Kommentars dienen kann.
Liebe und Schmerz sind die beiden Seiten einer Medaille. Vielleicht kann man Glück vor allem verstehen, wenn man Unglück kennt und Freude, wenn man Traurigkeit erlebt. Weil wir das Böse kennen, können wir uns deswegen erst bewusst machen, was das Gute ist. Die Philosophin Hannah Arendt spricht auf diese Weise von der Banalität des Bösen: Denn Angst und Schrecken sind es, die uns zu liebenden Menschen machen.
Marcel Proksch